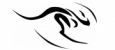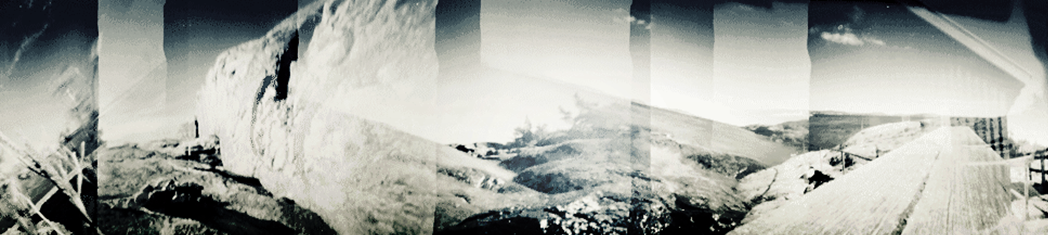Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Terminvereinbarungen bitte individuell per Mail: sandra.tiefel@ovgu.de
Zur Person
als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Pädagogik und Medienbildung forscht und lehrt Sandra Tiefel zu sozialen Exklusions- und Inklusionsprozessen in differierenden Settings und Prozessen.
Von 2016 bis 2022 war sie gewählte zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Otto von Guericke Universität Magdeburg und leitete das Büro für Gleichstellungsfragen. Ihre besondere Expertise lag in der erfolgreichen Kooperation zwischen Administration und Wissenschaft. Sie koordinierte die über PPIII geförderten Projekte zur Steigerung weiblicher wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen bis hin zu Professur (ein interdisziplinäres und zweisprachiges Mentoringprogramm und zusätzliche gleichstellungsfördernde Maßnahmen), ein ESF Projekt zur Rekrutierung von Frauen für den MINT Bereich sowie ein weiteres BMBF Projekt zur Geschlechterforschung. Sie ist Mitbegründerin des Magdeburger Gendercampus und des Netzwerks für Chancengleichheit und Diversität an der Universität. Gemeinsam mit der Stadt, dem Studentenwerk, der Hochschule Magdeburg/Stendal, der VHS Magdeburg, der Freiwilligenagentur und dem EineWeltHaus verantwortet sie eine Diversity Challenge zur Steigerung der Bürgerbeteiligung für ein weltoffenes Magdeburg.
Sie ist seit über 20 Jahren aktiv im Vorstand des Zentrums für Sozialweltforschung und Methodenentwicklung und als Koordinatorin und Lehrende des Promotionsstudiengangs „Qualitative Bildungs- und Sozialforschung“ ausgewiesene Expertin in Qualitativen Forschungsmethoden insbesondere Grounded Theory.
Studium
| WS91/92-SS97 | „Diplompädagogik“ mit dem Zusatzfach Beratung an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen. Diplom mit Auszeichnung (1,1), Diplomarbeit „Bewusste Berufs- und Lebensplanung als Aufgabe der Freizeitpädagogik. Förderung sozialer Kompetenzen von Mädchen und Jungen durch kreative Gruppenarbeit |
Promotion zur professionellem Beratungshandeln bei konflikthaften sozialen Beziehungen und biografischen Veränderungsprozessen
| 01/99-03/02 | Promotion als Stipendiatin im Hans-Böckler-Promotionskolleg „Biographi-sche Risiken und neue professionelle Herausforderungen“ der Universitäten Halle und Magdeburg. Dissertation „Beratung und Reflexion – eine quali-tative Studie zum professionellen Beratungshandeln unter Modernisierungsbedingungen“ am Institut für Erziehungswissenschaften der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Note: „summa cum laude“ |
Beratungs- und Bildungsarbeit im Kontext beruflicher Übergänge
| 09/94-09/95 | Konzeption und Durchführung von LehrerInnen-Fortbildungen im Pädago-gischen Landesinstitut Brandenburg (PLIB) Ludwigsfelde im Rahmen des Modellversuchs „Berufsorientierung für Mädchen und Jungen“. Blockveran-staltungen zu Didaktik und Methodik im Unterrichtsfach Arbeitslehre. |
| 04/96-10/96 | Werkvertrag über die Erprobung und Entwicklung von didaktischem Mate-rial „Zur Stärkung des Selbstwertgefühls zur bewussten Berufs- und Lebens-planung von Mädchen und Jungen im Rahmen von Unterricht und Jugendarbeit“ im Auftrag des Pädagogischen Seminars der Georg-August-Universität Göttingen und des Niedersächsischen Frauenministeriums. |
| 08/97-10/01 | Beratungsfachkraft in den Bereichen Berufsorientierung und Weiterbildung im Verein zur Erschließung neuer Beschäftigungsformen (VEBF e.V.) in Göttingen. Konzeption, Planung und Durchführung von Beratungs- und Bildungsangeboten für SchülerInnen, Auszubildende, Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen. (01/00 – 10/01 Vorstandsmitglied). |
Zusatzausbildungen für Bildungs- und Beratungsarbeit
| ‘93-‘95 | Ausbildung zur Spielleiterin im Bereich ‘Szenisches Spiel als Lernform’ |
| ‘94-’95 | GruppenleiterInnen-Ausbildung: ‘Kreative Rezeption’ |
| ’03-‘04 | Ausbildung in hochschuldidaktischen Beratungsformaten mit Schwerpunkt: „Promotionscoaching“ im Hochschuldidaktischen Zentrum der Universität Dortmund. |
Wissenschaftliche Tätigkeiten
| SS94-SS97 | Studentische Hilfskraft am Institut für Pädagogische Psychologie, Göttingen. Mitarbeit an einer qualitativen Studie zu Moral- und Idealvorstellun-gen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. | |
| 08/97-03/99 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Pädagogische Psychologie des Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie, Göttingen. Auswertungen von halbstandardisierten und problemzentrierten Interviews anhand der Methode der Objektiven Hermeneutik. | |
| 10/01-09/04 | Geschäftsführerin des Zentrums für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung (ZBBS) Magdeburg auf Basis eines Post-doc-Stipendiums des Kultusministeriums Sachsen-Anhalts: Forschungsorganisation, Antragszuarbeiten, Veranstaltungsmanagement, Mitarbeit bei der Entwicklung, Etablierung und Lehre des Graduiertenstudiengangs „Qualitative Bildungs- und Sozialforschung“, organisatorische und fachliche Betreuung und Beratung von über 20 NachwuchswissenschaftlerInnen pro Jahrgang, Redaktion der Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung, Öf-fentlichkeitsarbeit. | |
| seit 10/04 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin (unbefristet) am Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik (Leiter: Stefan Iske) – verantwortlich für den Bereich Bildung und Soziale Arbeit mit den Arbeits- und Forschungsschwerpunkten Beratung, Bildung, Pädagogische Professionalität, Gender und qualitative Bildungs- und Sozialforschung. 03/07-02/08 und 03/09-02/10 Elternzeit Fachstudienberaterin für den BA-Studiengang (bis 2016) |
|
| seit 10/04 | Koordinatorin des Promotionsstudiengangs „Qualitative Bildungs- und Sozialforschung sowie Lehrende. (Zuvor seit 2002 Leitung der Oberseminare des Kollegs „Biografische Risiken und professionelle Herausforderungen“ der Hans-Böckler-Stiftung am Standort Magdeburg“) | |
| 07/16 – 09/22 | Gewählt und Abgeordnet als zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Otto von Guericke-Universität Magdeburg | |
| 09/22 -01/23 | Koordinatorin für OVGU Diversitätsstrategie (50%) | |
| 02/23-06/23 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Forschungsprojekt „Inklusion und Digitalisierung“ an der Professur von Olaf Dörner (OVGU) (50%) |
Drittmittel
| 10/01-09/03 | Post-Doc Stipendiatin des Landes Sachsen-Anhalts |
| 01/08-12/12 | Koordinatorin des DFG geförderten Netzwerks „BILDUNGSVERTRAUEN – VERTRAUENSBILDUNG zur Rekonstruktion von Prozessen der Vertrauensbildung in sozialen und professionellen Kontexten“ (bildungsvertrauen.de) |
| 09/11-06/12 | 50%-Stelle aus der Brückenfinanzierung zur Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses in Sachsen-Anhalt zur Vorbereitung meines Habilitationsprojektes: „Vertrauen in Arbeitsbündnissen der Sozialen Arbeit. Eine empirische Analyse zur Bedeutung von Beziehungen zwischen Professionellen und AdressatInnen in Beratungs- und Hilfeprozessen.“ |
| Verantwortliche Antragstellerin und Projektleitung | |
|
07/22-01/23 50.000Euro
|
BMBF-Förderung Konzeptphase „Geschlechteraspekte im Blick“
Das Gesamtziel des Projekts „Gender- & Diversitäts-Innovationsräume als partizipative Austausch- und Supportstrukturen institutionell an Universitäten verankern“ liegt in der Entwicklung eines digitalen Tools zur (Forschungs-)Projektplanung und Antragstellung, um Gleichstellung zu fördern, Gender- und Diversitätsaspekte in die eigene Forschung zu integrieren, Informationen und Serviceangebote zu bündeln und Projektmanagementprozesse zu unterstützen. Aufbauend auf der GERD-APP (GERD | Gender Extended Research and Development Model (gerd-model.com) soll gemeinsam mit Prof. Claude Draude (Mitentwicklerin von GERD) eine Grundlage für die Entwicklung einer digitalen Umgebung zur Forschungsplanung und Antragstellung zunächst am Standort Magdeburg realisiert werden. |
|
2014-2019 450.000 Euro |
Professorinnen Programm II
I Zusätzliche Gleichstellungsmaßnahmen zur Erhöhung der Teilhabe der Frauen, Erhöhung des Anteils weibl. Professoren, Nachwuchsförderung und Vereinbarkeit von Studium, Lehre, Forschung und Familie II Ausbau des Mentoringprogramms für Wissenschaftlerinnen als eine Säule strategischer Personalentwicklung an der OVGU durch Modularisierung der Bildungsangebote, Implementierung in den Katalog Wissenschaftlicher Weiterbildung und Anerkennungsmöglichkeiten für das Zertifikat der Hochschuldidaktik der OVGU (Ausbau des Mentor*innenpools, Ausbau der Angebote für Neuberufenen und Juniorprofessor*innen (z.B. als Weiterbildungsangebote zum „Mentor*in sein“, Coaching etc.), Ausbau und Systematisierung der Kooperationen mit Forschungseinrichtungen; Forschungsförderung und Career Service) |
|
2019-2024 450.000 Euro |
Professorinnen Programm III
I „Systematische Planung und Organisation von „Doppelpotenzial“-Gleichstellungsmaßnahmen: Die OVGU favorisiert zur Herstellung von Chancengerechtigkeit „Doppelpotenzial“-Maßnahmen, die zusätzlich zur Unterstützung exzellenter Wissenschaftlerinnen auch immer den Nutzen für Arbeitsbereiche (Lehrstühle, Institute, Fakultäten oder Forschungsverbünde und -gruppen) integrieren. Hierbei werden zwei zentrale Gleichstellungsziele miteinander verbunden: Steigerung der Attraktivität der OVGU als chancengerechter Studien- und Arbeitsort und Förderung von Netzwerken zum Auf- und Ausbau von interdisziplinären und/ oder internationalen Forschungskooperationen und strategischer wissenschaftlicher Karriereplanung. II -Weiterführung des bilingualen Mentoringprogramms COMETiN, Ausbau des bestehenden Mentor*innenpools, Dokumentation erfolgreicher Alumnaes als Role Models auf den Karriereseiten der OVGU, Aufbau eines Coachingpools zur strategischen Personalentwicklung, Bildung eines regionalen Mentoringnetzwerkes Mitteldeutschland, Bildung eines Nachwuchspool zur gegenseitigen Rekrutierung aus den „Nachbar“-Hochschulen Ziel mit Abschluss der Förderung: Modularisierung des Mentoringprogramms COMETiN an der OVGU als integriertes Angebot strategischer Personalentwicklung mit Geschlechter- und Diversitätsperspektive im Bereich des wissenschaftlichen Mittelbaus |
| 2016-2022
1.900.000 Euro
|
FEM POWER ist ein ESF-finanziertes landesweites Programm zur Förderung und Herstellung von Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung. Es ist im Landesprogramm für ein geschlechtergerechtes Sachsen-Anhalt verankert.
Im Rahmen von FEM POWER OVGU wird Gleichstellungsarbeit an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg durch verschiedene, aufeinander abgestimmte, dennoch alleinstehende Maßnahmen unterstützt und strukturell weiter verankert: MINT Rekrutierung und Post Doc Förderung, Antidiskriminierungskampagne Ein zweiter Schwerpunkt ist die Förderung der Integration von Genderforschung in Lehre und Forschung: Gender Campus; Nachwuchstagung im Kontext des Landesweiten Tags der Geschlechterforschung; Interdisziplinäre Forschungsmesse |
Sonstiges
| seit 10/02 | Aktives Mitglied der GEW-Hochschulgruppe |
| seit 02/03 | AG-Leitung beim jährlichen Methodenworkshop des Magdeburger Zent-rums für Sozialweltforschung und Methodenentwicklung (ZSM) zum Besprechen und Überarbeiten von Forschungsdesigns in der Planungsphase (Forschungsmethoden: Narrationsanalyse, Grounded Theory, Objektive Hermeneutik, Dokumentarische Methode, Ethnographie) gemeinsam mit Prof. Fabel-Lamla. |
| seit 02/05 | Workshops zur Methodologie und Methode der Grounded Theory mit Promovierenden (auf Anfrage 2-3x jährlich) |
| 06/04 | Verleihung des Fakultätspreis für die Forschungsleistungen im Rahmen der Dissertation |
| 06/12 – 09/16 | Mittelbauvertreterin im Vorstand des IEW |
| 10/12 – 09/16 | Personalratsmitglied an der Universität |
| seit 10/12 | Mitglied des Hauptpersonalrates am Wissenschaftsministerium im Land Sachsen-Anhalts |
| 09/13, 09/15, 09/16, 09/23 | Nominierung für den Lehrpreis der Otto von Guericke Universität Magdeburg durch Studierende. |
Forschung
Forschungsschwerpunkte
- Vertrauensforschung in pädagogischen Interaktionen und sozialen Arenen
- Beratung als pädagogische Metakompetenz und Arbeitsfeld
- Professionalität pädagogischen Handelns
- Soziale Arbeit und gesellschaftliche Modernisierung
- Qualitative Bildungsforschung (insbesondere Grounded Theory nach Strass/Corbin)
Publikationen
2022
- Kondratjuk, Maria/ Dörner, Olaf/ Tiefel, Sandra/ Ohlbrecht, Heike (Hrsg.) (2022): Qualitative Forschung auf dem Prüfstand. Beiträge zur Professionalisierung qualitativ-empirischer Forschung in den Sozial- und Bildungswissenschaften. Verlag Barbara Budrich, Bielefeld.
2021
- Ohlbrecht, Heike/ Detka, Carsten & Tiefel, Sandra (Hrsg.) (2021). Anselm Strauss – Werk, Aktualität und Potenziale. Mehr als Grounded Theory. Opladen: Barbara Budrich.
- Hille, Julia/ Piel, Julia/ Taube, Vera & Tiefel, Sandra (2021). Vertrauen und psychischer Gesundheit in Arbeitsallianzen: Rekonstruktion differenzierter Erkenntnis durch Vergleich – eine Hommage an Anselm Strauss‘ Forschungshaltung (S. 155-202). In Heike Ohlbrecht/ Carsten Detka & Sandra Tiefel (Hrsg.) (2021). Anselm Strauss – Werk, Aktualität und Potenziale. Mehr als Grounded Theory. Opladen: Barbara Budrich.
- Tiefel, Sandra & Kondratjuk, Maria (2021). Vagheit und Tentativität als bildungsrelevante Schlüsselkompetenzen. Reflexionen über die Praxis der Forschungswerkstatt Zur qualitativen Forschung auf Basis von Anselm Strauss‘ Theorie sozialer Welten und Arbeitsbogen-Konzept (S. 202-220). In Alexa M. Kunz/ Günther Mey/ Jürgen Raab & Felix Albrecht (Hrsg.), Qualitativ Forschen als Schlüsselqualifikation. Prämissen – Praktiken – Perspektiven. Weinheim: Beltz Juventa
2016
- Tiefel, Sandra (2016): Biografieorientierte Familienberatung zwischen Einzelfallhilfe und sozialer Verantwortung. In: Giesecke. Wiltrud; Nittel, Dieter (Hrsg.): Handbuch Pädagogische Beratung über die Lebensspanne. Beltz/Juventa Weinheim und Basel, S. 656-665
- Tiefel, Sandra (2016): Lebensbewältigung als Heuristik in qualitativen Forschungsdesigns. Mögliche Analyseperspektiven und –verfahren. In: Litau; Walther; Warth; Wey (Hrsg.), Theorie und Forschung zur Lebensbewältigung, Beltz Verlag, Weinheim Basel, S. 88-108
2014
- Tiefel, Sandra (2014): Vertrauen. In: Dick, M. et al. (Hrsg.): Handbuch Professionsentwicklung. Bad Heilbrunn
2013
- Tiefel, Sandra; Zeller, M. (2013): Vertrauen von AdressatInnen der Sozialen Arbeit In: Bartmann, Sylke; Fabel-Lamla, Melanie; Pfaff, Nicolle; Welter Nicole (Hrsg.): Vertrauen in der erziehungswissenschaftlichen Forschung. Leverkusen
2012
- Tiefel, Sandra (2012): Schwarz, Martin P.; Dewe, Bernd (2011): Beraten als professionelle Handlung und pädagogisches Phänome. In: REPORT Zeitschrift für Weiterbildungsforschung/2012: System und Systemsteuerung in der Erwachsenenbildung
- Fabel-Lamla, M.; Tiefel, Sandra; Zeller, M. (2012): Vertrauen und pädagogische Professionalität – Ein Überblick über theoretische Ansätze und empirische Analysen. In: Zeitschrift für Pädagogik 58 (2012), Heft 6
- Tiefel, Sandra (2012): Beratung. In: Thole, W.; Höblich, D.; Ahmed, S. (Hrsg.): Taschenwörterbuch Soziale Arbeit. Bad Heilbrunn: 32-34
- Tiefel, Sandra (2012): Strategische Dimensionen der Vertrauensherstellung im Beratungsprozess – empirische Rekonstruktion der subjektiven Theorien von Beratern und Beraterinnen aus sozialpädagogischen Arbeitsfeldern. In: Tiefel, S.; Zeller, M. (Hrsg.) (2012): Vertrauensprozesse in der Sozialen Arbeit. Schneider Verlag. Baltmannsweiler
- Tiefel, Sandra (2012): Kommunikation des Vertrauens in (sozial-)pädagogischen Kontexten. In: I.U. Dalferth; S. Peng-Keller (Hrsg.): Kommunikation des Vertrauens, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt: 155-174
- Tiefel, Sandra; Zeller, M. (Hrsg.) (2012): Vertrauensprozesse in der Sozialen Arbeit. Schneider Verlag. Baltmannsweiler
2011
- Tiefel, Sandra (2011): Bildung. In: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Fachlexikon der Sozialen Arbeit. 7. Völlig überarbeitetet und aktualisierte Auflage. Baden-Baden: 117-120
- Tiefel Sandra (2001): Grounded Theory. In: Horn, K.-P.; Kemnitz, H.; Marotzki, W.; Sandfuchs, U. (Hrsg.): Lexikon Erziehungswissenschaft. Bad Heilbrunn
2010
- Tiefel Sandra (2010): Qualitative Bildungsforschung. In: Friebertshäuser, Langer, Prengel (Hrsg.): Handbuch Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim und München (Juventa) 2010. S. 73-88
2007
- Tiefel, Sandra (2007): Rezension zu Seale, Clive; Giampietro, Gobo; Gubrium, Jaber F.; Silverman, David (Ed.): Qualitative Research Practice. London, Thousand Oaks, New Dehli, 620 Seiten. In: Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung (ZBBS), 7. Jg.
- Bartmann, Sylke; Sandra Tiefel (2007): Biographische Ressource’ und ‚Biographische Reflexion’: zwei sich ergänzende Heuristiken zur erziehungswissenschaftlich orientierten Analyse individueller Erinnerungs- bzw. Biographiearbeit. In: Dörr, M.; Felden, H. v.; Klein, R.; Macha, H.; Marotzki, W. (Hg.): Erinnerungsarbeit (Arbeitstitel). Vergessen – Erinnern – Leben. Wiesbaden
- Tiefel, Sandra et. al. (2007): Bildungsvertrauen – Vertrauensbildung. Antrag bei der DFG zur Förderung eines wissenschaftlichen Netzwerks zur Rekonstruktion von Vertrauensbildungsprozessen in sozialen und professionellen Kontexten. www.bildungsvertrauen.de
2006
- Tiefel, Sandra (2006): Verlagssuche und Vertragsverhandlungen. In: Tiefel, S.; Koepernik, C.; Moes, J. (Hrsg.): GEW-Handbuch Promovieren mit Perspektive. Bielefeld, S. 395-402
- Tiefel, Sandra (2006): Publikation und Profession. In: Tiefel, S.; Koepernik, C.; Moes, J. (Hrsg.): GEW-Handbuch Promovieren mit Perspektive. Bielefeld, S. 377-379
- Tiefel, Sandra (2006): Promovieren in Kollegs und Zentren: Entwicklung, Zielsetzungen und Angebote verschiedener Modelle strukturierter Promotion in Deutschland. In: Tiefel, S.; Koepernik, C.; Moes, J. (Hrsg.): GEW-Handbuch Promovieren mit Perspektive. Bielefeld, S. 377-379
- Tiefel, Sandra (2006): Zur Komplexität der Herausforderungen des Promovierens In: Tiefel, S.; Koepernik, C.; Moes, J. (Hrsg.): GEW-Handbuch Promovieren mit Perspektive. Bielefeld, S. 377-379
- Tiefel, Sandra (2006): Bildung/ Bildungswesen. In: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hg.): Fachlexikon der sozialen Arbeit. 5., aktualisierte Aufl. Gelsenkirchen
- Tiefel Sandra; Koepernik, Claudia; Moes, Johannes (Hrsg.) (2006): GEW-Handbuch Promovieren mit Perspektive. Bielefeld
2005
- Tiefel, Sandra (2005): Kodierung nach der Grounded Theory lern- und bildungstheoretisch modifiziert: Kodierleitlinien für die Analyse biographischen Lernens. In: Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung (ZBBS), 6. Jg., H. 1, S. 65-84
- Tiefel, Sandra (2005): Biografische Arbeit als pädagogische Herausforderung. In:Forum Erziehungshilfen 3/2005. S. 134-139.
2004
- Tiefel, Sandra (2004): Auf dem Weg zu einer pädagogischen Beratungstheorie? Ein empirisch generiertes Modell zu professioneller Reflexion in der Beratungspraxis. In Ders. (Hrsg.): Biographische Risiken und neue professionelle Herausforderungen. Wiesbaden, S. 107-128
- Fabel, Melanie; Tiefel, Sandra (2004): Biographie als Schlüsselkategorie qualitativer Professionsforschung. Ein Vergleich empirischer Studien über professionelles Handeln in etablierten und neuen Berufsgruppen ‑ Einleitung. In: Ders. (Hrsg.): Biographische Risiken und neue professionelle Herausforderungen. Wiesbaden, S. 11-40
- Fabel, Melanie; Tiefel, Sandra (2004): Biographische Risiken und neue professionelle Herausforderungen. Wiesbaden
- Tiefel, Sandra (2004): Beratung und Reflexion. Eine qualitative Analyse und theoriebasierte Definition professioneller Reflexion im Beratungskontext. Wiesbaden
2003
- Tiefel, Sandra (2003): Die formale und die deskriptive Interviewanalyse und ihre Potenziale für die vergleichende Kodierung offener und teilstandardisierter Interview. In: Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung (ZBBS), 4. Jg., H. 1, S. 153-162
- Fabel-Lamla, Melanie; Tiefel, Sandra (2003): Methoden-Triangulation von offenen und teilstandardisierten Interviews: Zwei Beispiele aus der Forschungspraxis. In: Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung (ZBBS), 4. Jg., H. 1, S. 143-145
- Fabel-Lamla, Melanie; Tiefel, Sandra (2003): Fallrekonstruktionen in Forschung und Praxis. Einführung in den Themenschwerpunkt. In: Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung (ZBBS), 4. Jg., H. 2, S. 189-198
- Fabel-Lamla, Melanie; Tiefel, Sandra (Hrsg) (2003): Fallrekonstruktionen in Forschung und Praxis. In: Themenheft der Zeitschrift für Qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung (ZBBS), 4. Jg./H. 2
2002
- Tiefel, Sandra; Vortherms, Doris; Winkler, York (2002): Arbeit finden mit System. Berufspraxis und Studienerfahrung nutzen. Ja zur beruflichen Neuorientierung. Neue Wege zum Beruf. Regensburg/ Berlin Walhalla